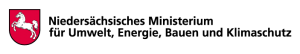Wiedervernässung. Und dann? – Bericht Klimaschutz durch Moorschutz – Fokus Niedersachsen am 06.04.2024
Am Samstag, den 06.04.24 lud uns Frau Dr. Greta Gaudig, die Leiterin des Greifswald Moor Centrums und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Greifswald, mit Ihrer Präsentation in eine ganz besondere Welt ein: Die Welt der Moore. So widmeten wir uns an diesem Vormittag der Kernfrage: Wie können wir, indem wir Moore schützen, das Klima schützen?
Zu Beginn erläuterte Frau Dr. Gaudig einige Grundlagen. Moore entstehen als Feuchtgebiete in Landschaften mit einem Wasserüberschuss. Durch ihren Wasserreichtum und ihre Nährstoffknappheit bieten sie extreme Lebensbedingungen. Doch viele Tier- und Pflanzenarten haben sich genau an diesen Standort angepasst und können außerhalb nicht mehr existieren. Daher leben in den letzten intakten Mooren viele gefährdete Arten. Da abgestorbene Biomasse in Torf umgewandelt und nicht zersetzt wird, sind Moore effektive Kohlenstoffspeicher und spielen damit für den Klimaschutz eine große Rolle. Obwohl sie weltweit nur 3 % der Landfläche bedecken, speichern sie doppelt so viel Kohlenstoff, wie alle Wälder der Welt. In Deutschland sind 5 % der Landfläche von Mooren bedeckt, allerdings sind davon nur noch 1-2 % naturnah. Der Rest wurde entwässert und wird für Torfabbau oder für die Landwirtschaft genutzt. Doch durch die Trockenlegung wird CO2 freigesetzt, was sich auch auf die Gesamtbilanz der dort produzierten Lebensmittel auswirkt. Außerdem sackt der Torfkörper durch die Entwässerung in sich zusammen.Die meisten deutschen Moore liegen in Niedersachsen, dementsprechend sind auch die CO2-Emissionen auf Moorentwässerung in Niedersachsen am höchsten. Sie liegen in der Liste der größten CO2-Produzenten auf Platz zwei.
Wie kann diesem Trend entgegengewirkt werden? Frau Dr. Gaudig gab eine einfache Antwort: Wiedervernässung. Und dann? Alles renaturieren und ein Refugium für Tiere und Pflanzen schaffen. Doch mehr als dreiviertel der Moore werden landwirtschaftlich genutzt. Diese Nutzung einzustellen, würde für die Landwirte zu hohen Verlusten führen. Doch es gibt Alternativen. Am Greifswald Moor Centrum wird in Kooperation mit anderen Partnern u. a. in Niedersachsen intensiv an Paludikulturen geforscht. Dieser Anbau auf wiedervernässten Flächen kann z.B. Schilf für den Reetdachbau, Rohkolben als Viehfutter oder Dämmmaterial oder Torfmoos als Torfersatz im Gartenbau liefern. Und gleichzeitig wertvollen Sekundärlebensraum für viele Moorbewohner schaffen. Leben von und mit der Natur, im Einklang mit der Natur – ist es nicht das, was wir alle uns wünschen? Die Forschungen von Frau Dr. Gaudig und ihre Kolleg*innen zeigen, dass dies auch im Fall von Mooren geht. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Erfolgserlebnisse bald in größerem Stil umgesetzt werden.
Wir bedanken uns bei Frau Dr. Gaudig für den wunderbaren Vortrag und bei allen Teilnehmenden für das Zuhören, für die spannenden Fragen und für die Beiträge während der Diskussion.
Online-Vortrag „Klimaschutz durch Moorschutz – Fokus Niedersachsen“
Sa. 06. April 2024 | 10 – 13:00 Uhr | Ort: Online | Zielgruppe: Interessierte
In Anbetracht der Klimakrise als auch der Biodiversitätskrise geraten Moore zunehmend ins Blickfeld der Akteure. Intakte Moore sind Hotspots der Artenvielfalt und bieten vielen gefährdeten Tier- und Pflanzenarten Lebensraum und Nahrung. Sie filtern und speichern große Mengen Wasser und spielen so eine wichtige Rolle im (Hoch)Wassermanagement. Intakte Moore bilden Torf, legen so langfristig CO2 fest und wirken als natürliche CO2-Senke. Moore speichern doppelt so viel Kohlenstoff wie die Wälder der Erde. Das macht sie als Player im Klimaschutz außerordentlich wichtig. Wenn Moore jedoch entwässert werden, wird CO2 wieder freigesetzt. In Deutschland ist der größte Anteil an Moorfläche trockengelegt und wird genutzt, i.d.R. als landwirtschaftliche Nutzfläche oder zum Torfabbau. Also ist die Sache ganz einfach? Moore wiedervernässen und renaturieren – Klima gerettet, Artenvielfalt gefördert?
Mit Frau Dr. Greta Gaudig vom Greifswald Moor Centrum wollen wir uns der Rolle der Moore für den Klimaschutz nähern. Von der Entstehung der Moore und ihrer derzeitigen Situation bis hin zu nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten werden wir uns anschauen, wie Moorschutz zum Schutz von Klima, Biodiversität, Wassergüte usw. beitragen kann. Die Referentin stellt dazu einige eigene Moorschutzprojekte in Niedersachsen vor und steht dann für Fragen und zur Diskussion zur Verfügung.
Hinweis: Die Schulung findet online als Schulung über „Zoom“ statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie über eine E-Mail mit der Anmeldung im LabüN (weitere Infos zur Anmeldung siehe unten).
Teilnahmebescheinigung: ja
Referentin: Dr. Greta Gaudig
Anmeldung:
Bis zum 04.04.2024 per Email an info@labuen.de
Bitte geben Sie im Betreff Ihrer Email den Titel und das Datum der Schulung an. Nennen Sie zudem bitte Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse sowie Ihren Naturschutzverband (LFV, AVN, BUND, LBU, LJN, NABU, NVN oder SDW) mit Angabe der Orts- bzw. Kreisgruppe und ggf. Ihrer Funktion in Ihrem Verband.
Hinweis: Ihre Teilnahme geben wir Ihrem Verband bekannt, damit dieser erfährt, wie groß die Nachfrage bzw. der Bedarf nach diesem Schulungsangebot im Ehrenamt ist.
Bericht von der Online-Schulung „EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)“ am 07.03.2024
Menschen, Tiere und Pflanzen benötigen Wasser zum Überleben. Das Wasser der Erde kann zwar nicht aufgebraucht werden (wie Kohle oder Erdöl), jedoch ist die Menge, die nachhaltig nutzbar ist, begrenzt. Aus diesen Gründen wurde im Jahr 2000 die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) als europäisches Instrument für den langfristigen Schutz aller Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und für die Sicherung der Wasserressourcen für den Menschen eingeführt.
Im ersten Teil der Schulung haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum die Ressource Wasser geschützt werden muss. Aufbauend darauf wurde eine Einführung in die Hintergründe, die Entstehung, die Ziele, den Inhalt sowie die rechtliche Verankerung der WRRL gegeben.
Der zweite Teil der Schulung befasste sich mit der WRRL in Niedersachsen. Hier wurden neben der Umweltkarte Niedersachsen als Anwendung für die Suche, Anzeige und Nutzung von geografischen Informationen zum Thema WRRL auch die Steckbriefe zu den Flussgebietseinheiten vorgestellt. Nachdem ein kurzer Einblick in die Hintergründe der Erstellung des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie gegeben wurde, wurde der Stand der Umsetzung der WRRL für Deutschland dargestellt.
Die WRRL war unter allen Teilnehmenden ein bekanntes Thema. Anhand der gestellten Fragen wurde wieder einmal deutlich, dass es Bedarf gibt, die Organisationsstruktur besser verstehen zu können und auch, wie es nach dem Ablauf der 2027-Frist mit der WRRL weiter gehen wird.
Neuerungen im Artenschutz – Bericht von der Online-Schulung „Artenschutz(recht)“ am 27.01.2024
Für die Realisierung von Planungs- und Zulassungsvorhaben ist eine rechtssichere Prüfung und Abarbeitung des Artenschutzrechts unbedingt notwendig. Welche Regelungen dabei in Bezug auf den Artenschutz bei Beteiligungsverfahren zu beachten sind, wurde durch ein vielseitiges Programm in der Schulung erklärt.
Im ersten Teil der Schulung haben wir uns mit den rechtlichen Grundlagen beschäftigt und wie sich der allgemeine und der besondere Artenschutz unterscheiden. Es wurde darauf eingegangen was Zugriffsverbote sind, welche Sonderregelungen in Bezug auf diese greifen, wie geeignete Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen aussehen und welche artenschutzrechtlichen Ausnahmen es gibt. Vor der Pause wurden noch einige der aktuellsten Rechtsprechungen erläutert.
Der zweite Teil der Schulung befasste sich mit den relevanten Artengruppen und wie diese in welcher Tiefe untersucht und berücksichtigt werden müssen. Ebenfalls wurde auf die einzelnen Planungsebenen eingegangen und welche Rolle die Verfahrensführenden- und Naturschutzbehörden bei Beteiligungsverfahren spielen. Die wichtigsten Arbeitsschritte, die für die Abarbeitung des Artenschutzes in Planungs- und Zulassungsverfahren relevant sind, wurden anhand von Ablaufschemata erläutert. Zudem wurden einige Beispiele für Fehlerquellen bei Abwägungsentscheidungen in Bezug auf den Artenschutz genannt und auf verschiedene Aspekte, die bei der Bewertung der Artenschutzbelange und Zugriffsverbote zu beachten sind, eingegangen. Eine aktuelle Rechtsprechung wurde anhand eines Praxisbeispiels erläutert und ein Bezug zur ehrenamtlichen Arbeit hergestellt.
Die zahlreichen Fragen der Teilnehmenden zeigten, dass das Ehrenamt bei der Verbandsbeteiligung häufig mit ähnlichen Problemen im Artenschutz zu kämpfen hat.
Bericht zum Online-Vortrag „Naturverträglicher Ausbau von PV-Freiflächenanlagen – Wie geht das?“ am 23.09.2023
Vor gut einem Monat „trafen“ sich rund dreißig Ehrenamtliche online, um sich über ein aktuelles Thema zu informieren und auszutauschen: Wie sieht ein naturverträglicher Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen aus? Frau Dr. Julia Wiehe, Referentin für naturverträgliche Solarenergie im Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende KNE gGmbH aus Berlin ist es gelungen, dieses Thema auf eine greifbare Art und Weise darzustellen.
Zunächst hat Frau Dr. Wiehe die aktuellen Ausbauziele im Erneuerbar-Energien-Gesetz sowie die Ausbauziele von Niedersachsen erläutert. Neben den „klassischen“ PV-Freiflächenanlagen gibt es Potenziale im besiedelten Bereich, die ausgeschöpft werden können und so eine nachhaltige Umsetzung des EEG ermöglichen. Zahlreiche Visualisierungen sorgten für einen Einblick in die Vielfalt der Solarparks. Die Teilnehmenden bekamen verschiedene Kriterien an die Hand, die für die Bewertung der Naturverträglichkeit einer PV-Anlage ausschlaggebend sind. In diesem Zusammenhang sind die sogenannten „Biodiversitätssolarparks“ im Einklang mit einer nachhaltigen Landwirtschaft und fördern zugleich die Biodiversität auf der Fläche. Außerdem wurden auch Beispiele gezeigt, bei denen die Solarparks sowohl farblich als auch durch ihre Form an das Landschaftsbild und den Biotopverbund angepasst wurden. Es gibt somit einige Stellschrauben um einen Solarpark naturverträglich und „ästhetisch“ zu gestalten. Bei den Teilnehmenden kam die Frage auf wann die Ehrenamtlichen Stellung beziehen und ihr Wissen anbringen können. Im B-Planverfahren ist an mehreren Stellen die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. In diesem Prozess wird ein Bebauungsplanentwurf mit Begründung und Umweltbericht erstellt. Hier sollten die Interessierten ganz genau hinschauen. Wurden alle Kriterien für eine Naturverträglichkeit (u.a. Erhaltung schutzwürdiger Lebensräume, Durchgängigkeit, Verbot von Dünger) berücksichtigt und werden die Festsetzungen im B-Plan eingehalten?
In der zweiten Hälfte wurde den Ehrenamtlichen ein Raum für Fragen und Diskussion gegeben. Gegenstand der Diskussion war unter anderem „Photovoltaik auf Moorstandorten“. Es gibt aktuell kaum Praxisbeispiele und Erfahrungen zu den Auswirkungen auf die Natur. Einige Ehrenamtlichen haben sich klar dagegen ausgesprochen. Auch zum Thema „Schwimmende Photovoltaik“ gab es einige Einschätzungen und Meinungen. Es wird angenommen, dass solche Anlagen zur Verminderung der Verdunstung und zur Verringerung des Wellenschlags am Ufer beitragen. Aber auch dazu gibt es kaum wissenschaftliche Beiträge. Es gibt also potenziell noch einiges an Forschungsbedarf und bleibt somit ein spannendes Thema mit vielen Möglichkeiten und Chancen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien.
Wir bedanken uns bei Frau Dr. Wiehe für den wunderbaren Vortrag und bei allen Teilnehmenden für das Zuhören, für die spannenden Fragen und für die Beiträge während der Diskussion.
Schulung „EG-Wasserrahmenrichtlinie“ am 26.10.2024
Sa. 26. Oktoberber 2023 | 10:00 – 13:00 Uhr | Ort: Online | Zielgruppe: Interessierte
„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, dass geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“ (EG-WRRL).
An unsere Gewässer werden vielfältige Nutzungsansprüche u.a. aus den Bereichen Industrie, Land- und Fischereiwirtschaft sowie Tourismus gestellt. Dabei gilt es, die Wasserqualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers zu sichern, Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten zu schaffen, Wasser als Erholungsraum für den Menschen zu gestalten und sorgsam mit den Grundwasserreserven umzugehen.
Mit dem Inkrafttreten der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Dezember 2000 wurden neue Wege im Umgang mit den Gewässern in Europa aufgezeigt. Doch welche Ziele verfolgt die WRRL genau und wie werden sie umgesetzt? Wie können unsere Gewässer und das Grundwasser auch in Anbetracht der Klimakriese widerstandsfähiger gemacht werden?
Im Rahmen einer Online-Schulung sollen die Grundlagen, Ziele, der Zeitplan sowie die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie vertiefend vorgestellt werden.
Hinweis: Die Schulung findet online als Schulung über „Zoom“ statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie über eine E-Mail mit der Anmeldung im LabüN (weitere Infos zur Anmeldung siehe unten).
Teilnahmebescheinigung: ja
Referentinnen: N.N.
Programm:
17:00 Begrüßung
17:15 Wasserrahmenrichtlinie – Grundlagen
18:15 Pause
18:30 WRRL in der Praxis
19:45 Fragen, Fazit, Feedback
20:00 Ende der Veranstaltung
Anmeldung:
Bis zum 24.10.2024 per Email an info@labuen.de
Bitte geben Sie im Betreff Ihrer Email den Titel und das Datum der Schulung an. Nennen Sie zudem bitte Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse sowie Ihren Naturschutzverband (AVN, BUND, LBU, LFV, LJN, NABU, NVN oder SDW) mit Angabe der Orts- bzw. Kreisgruppe und ggf. Ihrer Funktion in Ihrem Verband.
Hinweis: Ihre Teilnahme geben wir Ihrem Verband bekannt, damit dieser erfährt, wie groß die Nachfrage bzw. der Bedarf nach diesem Schulungsangebot im Ehrenamt ist.
Schulung „EG-Wasserrahmenrichtlinie“ am 07.03.2024
Do. 07. März 2024 | 17:00 – 20:00 Uhr | Ort: Online | Zielgruppe: Interessierte
„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, dass geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“ (EG-WRRL).
An unsere Gewässer werden vielfältige Nutzungsansprüche u.a. aus den Bereichen Industrie, Land- und Fischereiwirtschaft sowie Tourismus gestellt. Dabei gilt es, die Wasserqualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers zu sichern, Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten zu schaffen, Wasser als Erholungsraum für den Menschen zu gestalten und sorgsam mit den Grundwasserreserven umzugehen.
Mit dem Inkrafttreten der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) im Dezember 2000 wurden neue Wege im Umgang mit den Gewässern in Europa aufgezeigt. Doch welche Ziele verfolgt die WRRL genau und wie werden sie umgesetzt? Wie können unsere Gewässer und das Grundwasser auch in Anbetracht der Klimakriese widerstandsfähiger gemacht werden?
Im Rahmen einer Online-Schulung sollen die Grundlagen, Ziele, der Zeitplan sowie die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie vertiefend vorgestellt werden.
Hinweis: Die Schulung findet online als Schulung über „Zoom“ statt. Die Zugangsdaten erhalten Sie über eine E-Mail mit der Anmeldung im LabüN (weitere Infos zur Anmeldung siehe unten).
Teilnahmebescheinigung: ja
Referentinnen: N.N.
Programm:
17:00 Begrüßung
17:15 Wasserrahmenrichtlinie – Grundlagen
18:15 Pause
18:30 WRRL in der Praxis
19:45 Fragen, Fazit, Feedback
20:00 Ende der Veranstaltung
Anmeldung:
Bis zum 05.03.2024 per Email an info@labuen.de
Bitte geben Sie im Betreff Ihrer Email den Titel und das Datum der Schulung an. Nennen Sie zudem bitte Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse sowie Ihren Naturschutzverband (AVN, BUND, LBU, LFV, LJN, NABU, NVN oder SDW) mit Angabe der Orts- bzw. Kreisgruppe und ggf. Ihrer Funktion in Ihrem Verband.
Hinweis: Ihre Teilnahme geben wir Ihrem Verband bekannt, damit dieser erfährt, wie groß die Nachfrage bzw. der Bedarf nach diesem Schulungsangebot im Ehrenamt ist.
Bundesnetzwerktreffen am 13.06.2023
In diesem Jahr fand das Bundesnetzwerktreffen der Landesbüros am 13.06.2023 im Landesbüro für anerkannte Naturschutzverbände (Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V.) in Brandenburg statt. Um sich auszutauschen und sich über die aktuellsten Veränderungen in den Landesbüros der jeweiligen Bundesländer zu informieren, kamen Vertreter*innen aus den Bundesländern Berlin, Brandenburg, NRW, Schleswig-Holstein und wir aus Niedersachsen in den Räumlichkeiten des Verbandes zusammen.
Ein zentrales Thema war der Ausbau von Erneuerbaren Energien durch Stromtrassen, Freiflächen-Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Die Problematiken sind innerhalb der Bundesländer ähnlich. Zum Beispiel wurde diskutiert wie eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gestaltet werden sollte, um möglichst naturverträglich zu sein. Die mangelnde Kenntnis über die Wirksamkeit diverser Maßnahmen macht ein konsequentes Monitoring umso dringender. Auch über die Notwendigkeit eines Katasters von Ausgleichsflächen waren wir uns einig.
Weiteres Thema des Bundesnetzwerktreffens war die Planungsbeschleunigung, die die Verbändebeteiligung zunehmend einschränkt. Insbesondere uns in Niedersachsen beschäftigt diese Problematik sehr, da wir durch das am 19. Mai 2022 beschlossene LNG-Beschleunigungsgesetz bereits bei den vereinfachten Genehmigungsverfahren von Flüssiggas-Terminals und zugehörigen Anlagen von stark verkürzten Fristen zur Abgabe von Stellungnahmen betroffen sind. Die Fristen sind meist so kurz, dass keine gemeinsamen Stellungnahmen durch das LabüN zustande kommen können. Hinzu kommt ein Fachkräftemangel, der auch in den Landesbüros zu spüren ist.
Der gemeinsame Austausch zeigte aber auch, dass bei den Landesbüros je nach Ausprägung ihres Bundeslandes ganz andere Thematiken im Fokus stehen. Im Gegensatz zu Niedersachsen als Flächenland, das stark von großen Infrastrukturhaben betroffen ist, hat Berlin als urban geprägter Stadtstaat völlig andere, aktuelle Probleme, die verstärkt dazu führen, dass innerhalb der Stadt wichtige Naturräume verloren gehen. Dazu gehört insbesondere die stark zunehmende Nachverdichtung, im Zuge derer Grünflächen, wie ungenutzte Friedhofsflächen und Kleingärten, in Bauland umgewandelt werden und als Rückzugsräume verloren gehen. Ein aktuelles Thema des Landesbüros in Berlin ist unter anderem die Frage welche klimaresilienten Gehölze für die Stadtbegrünung besonders geeignet und naturschutzfachlich wertvoll sind. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich das Landesbüro Schleswig-Holstein mit der Vision Nationalpark Ostsee.
Insgesamt gesehen war es ein sehr aufschlussreiches Treffen. Es hat gezeigt, dass ein Austausch innerhalb der Landesbüros über aktuelle Themen sehr hilfreich ist und für neue Erkenntnisse sorgt.
Neuerungen im Artenschutz – Bericht von der Online-Schulung „Artenschutz(recht)“ am 10.06.2023
Eine rechtssichere Prüfung und Abarbeitung des Artenschutzrechts ist heute die Voraussetzung für die Realisierung vieler Planungs- und Zulassungsvorhaben. Welche Regelungen dabei in Bezug auf den Artenschutz bei Beteiligungsverfahren zu beachten sind, wurde durch ein vielseitiges Programm in der Schulung erklärt.
Im ersten Teil der Schulung haben wir uns mit den grundlegenden, rechtlichen Regelungen beschäftigt und wie sich der allgemeine und der besondere Artenschutz unterscheiden. Es wurde darauf eingegangen was Zugriffsverbote sind, welche Sonderregelungen es in Bezug auf die Zugriffsverbote gibt, wie geeignete Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen aussehen und welche artenschutzrechtlichen Ausnahmen es gibt. Vor der Pause wurden noch einige der aktuellsten Rechtsprechungen erläutert.
Der zweite Teil der Schulung befasste sich mit den relevanten Artengruppen und wie diese in welcher Tiefe untersucht und berücksichtigt werden müssen. Ebenfalls wurde auf die einzelnen Planungsebenen eingegangen und welche Rolle die Verfahrensführenden- und Naturschutzbehörden bei Beteiligungsverfahren spielen. Die wichtigsten Arbeitsschritte, die für die Abarbeitung des Artenschutzes in Planungs- und Zulassungsverfahren relevant sind, wurden anhand von Ablaufschemata erläutert. Zudem wurden einige Beispiele für Fehlerquellen bei Abwägungsentscheidungen in Bezug auf den Artenschutz genannt und auf verschiedene Aspekte, die bei der Bewertung der Artenschutzbelange und Zugriffsverbote zu beachten sind, eingegangen. Eine aktuelle Rechtsprechung wurde anhand eines Praxisbeispiels erläutert und ein Bezug zur ehrenamtlichen Arbeit hergestellt.
Die zahlreichen Fragen der Teilnehmenden zeigten, dass das Ehrenamt bei der Verbandsbeteiligung häufig mit ähnlichen Problemen im Artenschutz zu kämpfen hat. Besonders interessiert waren die Teilnehmenden an den Neuerungen im BNatschG.
Bericht zu Online-Vortrag zum „Schutzgut Klima“ am 18.03.2023
Am Samstag, den 18. März kamen rund 50 Ehrenamtliche in der Online-Veranstaltung „Das Schutzgut Klima in Planungs- und Zulassungsverfahren“ zusammen. Der erste Teil des Vortrages wurde von Herrn Dr. Balla (Froehlich & Sporbeck GmbH & Co. KG) gehalten. Er vermittelte das Thema Rechtliche Regelungen mit Hilfe einer Übersicht zum Planungsrecht, mit Beispielen zum Lokalklima und zu Klimaanpassungen. In der räumlichen Planung unterscheidet man zwischen Klimaschutz- und Klimaanpassung-(Maßnahmen), was durch zahlreiche Beispiele erläutert wurde. Im zweiten Teil berichtete Herr Löwe (Bosch & Partner GmbH), wie der Klimaschutz bei Straßenbauvorhaben berücksichtigt wird.
Das Schutzgut Klima bekommt dank neuer Gesetze, wie dem Klimaschutzgesetz oder der Novellierung des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung, zunehmendes Gewicht in Planungs- und Zulassungsverfahren. Leider herrscht bei Behörden, Vorhabenträgern und Verbänden noch viel Unsicherheit bezüglich der Berücksichtigung dieses Schutzgutes im Planungsprozess. Die daraus resultierenden Mängel in den Planungsunterlagen werden häufig nicht erkannt. Der Vortrag hat dem Ehrenamt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte bei der Betrachtung des Schutzgutes Klima gegeben. Die Teilnehmer*innen der Schulung waren sehr interessiert und stellten viele Fragen zu dem Thema. Bereichert wurde der Austausch auch durch viele praktische Einzelfälle, welche in der Runde diskutiert wurden. Insgesamt gab der Vortrag die Möglichkeit, die wichtigsten Belange des Klimaschutzes im Planungs- und Genehmigungsprozess kennen zu lernen und zu diskutieren. Die Referenten konnten mit Ihren praktischen Erfahrungen für die notwendigen Informationen sorgen und standen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.